
Im April treffe ich zum ersten Mal Wolf Lotter, Journalist, Autor und Gründungsmitglied der brand eins. Nach einem kurzen Rückblick auf seine Lesung „Die kreative Revolution: Was wir vom Silicon Valley lernen müssen, um in die Wissensgesellschaft zu kommen“ sprechen wir im Interview über kreative Arbeit, Veränderung, Arbeit 4.0 und Selbstbestimmtheit.
Wolf Lotter zeigt in seiner Lesung die Unterschiede der Arbeits- und Innovationskultur im Silicon Valley und Europa auf. In den USA glaubt man an sich selbst, bei uns ist man eher der Auffassung, dass nur die Gemeinschaft etwas zustande bringt. Intellektuelle Arbeit wird weniger gewürdigt oder auch abschätzig kommentiert. Wir erinnern uns an „den Professor aus Heidelberg“ oder die „ehrliche Arbeit“, die mit Schweiß und Muskeln verrichtet wird. Eine Wissensgesellschaft verlangt aber vor allem persönliches, unterscheidbares Wissen und keine Reproduktion dessen, was wir bereits kennen. Industrie 4.0 ist kein digitales Fließband, sondern etwas völlig Neues. Auch wenn viele Sorgen haben, geht Lotter davon aus, dass so gut wie jede neue Technologie mehr Beschäftige hervorgebracht als vernichtet wurden. Beim Übergang von der Konsum- in eine Chancengesellschaft müssen wir Vorsorge für die Übergänge treffen.
Wir müssen Überraschungen willkommen heißen.
Die qualitative Ökonomie ist auf dem Vormarsch: „Wir können uns ändern und wir tun es auch“. Bühne frei für das Interview.
Herr Lotter, in Ihrer Lesung sprachen Sie davon, dass kreative Arbeit oder auch Wissensarbeit in Deutschland weniger gewürdigt wird als der schwitzende Arbeiter im Blaumann. In den USA ist das anders. Woran liegt das?
Die deutsche Arbeitsethik ist sehr stark vom Fleißbegriff geprägt. Fleiß bedeutet beständige Routine, also in etwas gut sein, das man immer wieder macht. Das findet in einer Kultur, die sehr stolz auf Normen, Standards und Regeln ist, eine hohe Resonanz. Das, was wir heute „Deutschland“ nennen, wurde im 19. Jahrhundert ganz entscheidend im Prozess der Industrialisierung durch den neuen deutschen Hegemonialstaat, das Königreich Preußen, geprägt. Dessen Aufstieg liegt in den militärischen Normen und anschließend in deren Anwendung im industriellen Arbeitsalltag begründet. Die deutsche Managementtheorie ist folgerichtig bis nach dem Zweiten Weltkrieg eine, die sich unmittelbar aus der preußischen Militärordnung ableitet. Hier geht es um Parieren, um Mitmachen, um Einordnen, um Unterordnen, kollektivistische Momente. Amerikas Aufstieg im 19. Jahrhundert verlangte das Gegenteil von Unterordnung, nämlich Eigeninitiative und Selbständigkeit in der Pionierzeit der „New Frontiers“ im Westen. Wer nicht improvisieren konnte, mit Überraschungen umgehen, der war geliefert. In Deutschland hingegen ist die Arbeitskultur auf Plan, Ordnung und Einordnung des Einzelnen ausgerichtet. Talente und Fähigkeiten werden nivelliert und nicht angeregt. Damit sind wir in allen neuen Bereichen, wo es wichtig ist, dass man Unterschiede erkennt, kulturell stark benachteiligt.
Blicken wir auf die Unternehmen. Eine KPMG-Studie sagt, dass 70 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass sich ihr Unternehmen in den nächsten drei Jahren signifikant verändern wird. Auf der anderen Seite erleben wir oft, dass Neues ein Etikett bekommt wie „Big Data“ oder „Arbeit 4.0“ und sich erstmal eine Zeit lang gar nichts tut. Es läuft ja auch gerade super. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Ich glaube, dass das eine wie das andere so nicht stimmt. Warum ausgerechnet in drei Jahren alles anders sein soll, ist mir rätselhaft. Die große Transformation von der Industrie- in die Wissensgesellschaft ist seit langem, seit den 60er Jahren, unterwegs, sie beschleunigt sich nur etwas. Big Data und Arbeit 4.0 verkaufen alten Wein in neuen Schläuchen. Wissensgesellschaft baut auf persönliches, unterscheidbares Wissen auf. Bei Big Data geht es um Datenmassen, die alte Illusion, dass mehr gleich mehr Qualität ist. Arbeit 4.0 wiederum ist der Versuch, eine Arbeitswelt aus der Industrialisierung samt Politik, Verbands- und Gesellschaftssystem in die Wissensgesellschaft zu retten – woran natürlich das Establishment ein großes Interesse hat. Aber wir müssen grundlegend neu denken. Die Erfolge, auf die so gern verwiesen sind, werden sich als Strohfeuer erweisen. Erstens sind sie einer gefährlichen Niedrigzinspolitik geschuldet, deren Echo wir noch spüren werden, und zweitens wiegen sie uns in der Illusion, dass wir so weitermachen könnten wie gehabt. Es ist oft so, dass sich vor einem beschleunigten Systemwechsel alte Systeme noch einmal aufbäumen – Alvin Toffler hat das in seinem Buch „Zukunftsschock“ das Phänomen des „Superindustrialismus“ genannt – vor mehr als vierzig Jahren war das also schon vorhersehbar.
Professor Peter Kruse sprach sich immer für einen Prozessmusterwechsel aus, statt der Funktionsoptimierung, die immer häufiger an ihre Grenzen stößt. So wie beim Fosbury-Flop, der Leichtathlet, der zum ersten Mal rückwärts über die Latte sprang. Brauchen wir mehr Menschen, die den Mut haben, auch mal aus der Reihe zu tanzen?
Natürlich. Nur die Differenz schafft Innovationen und Fortschritt, alles andere beschleunigt nur die Routinen und damit den falschen Eindruck, dass ein Rad sich immer weiterdreht.
Der Begründer der modernen Managementlehre Peter Drucker, der übrigens in Hamburg studiert hat, spricht in einem Harvard Business Manager Artikel davon, dass die Transformation zur Wissensgesellschaft bis 2020 abgeschlossen sein wird. Denken Sie auch, dass dieser Prozess so schnell vollzogen werden kann?
Mein 2005 verstorbener, von mir hochverehrter Landsmann war dabei ein wenig zu optimistisch, aber nicht übertrieben optimistisch. Wir erleben in den nächsten 10 bis 20 Jahren den definitiven Übergang. Die Primate sind ohnehin schon klar: Industrie 4.0, smartes Produzieren, Vorrang der personalisierten Produktion vor der Massenproduktion. Das wird kaum noch ernstzunehmend bezweifelt.
18,3 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland sind innerhalb der nächsten zehn bis 20 Jahre durch die Automation laut einer ING-Diba-Studie bedroht. Sie sagen oft, wir sollen uns weniger Sorgen um die bedrohten Arbeitsplätze machen, als um das Potenzial von kreativer Arbeit, dass dadurch freigesetzt wird. Aber stimmen dafür heute schon die Rahmenbedingungen? Was müssen wir tun, damit ein Kassierer nach seinem Job im Supermarkt ein Startup gründen kann – oder muss er das überhaupt?
Das ist ja das Gefährliche, wenn sie die Menschen immer nur von oben herab mit Fürsorge überschütten, zu Abhängigen des Staates und der Organisation machen, zu den „unselbständig Erwerbstätigen“, die man in Deutschland für das Ideal der Arbeitswelt hält. Wir brauchen Selbstständige. Selbstbestimmte. Jede Minute, jeder Cent, den wir in die Selbstfindung der Leute stecken, lohnt sich doppelt und dreifach. Ansonsten haben wir das Problem, dass Leute, die nie gelernt haben, sich selbst zu orientieren, zu verzweifelten Modernisierungsverlierern werden.
Wenn ich mich an meine Schulzeit an einem humanistischen Gymnasium erinnere, war das Thema „Wirtschaft“ bestenfalls ein Randthema. Dabei wurde viel Wert daraufgelegt, neue Technologien möglichst kritisch zu beleuchten. Was muss sich an den Schulen, den Hochschulen tun, damit wir mit dem Silicon Valley Schritt halten können?
Wir müssen Zivilkapitalisten werden, wie ich es in meinem Buch genannt habe. Zu Menschen, die selbst soviel von Ökonomie verstehen, dass sie sich durchs Leben bringen können – und zwar selbstbestimmt und nicht von einer Notlage zur nächsten. Wirtschaftliches Wissen ist die Voraussetzung für materielle Ökonomie. Dagegen kann man nur etwas haben, wenn einem abhängige Leute lieber sind als mündige. Aber dann ist man klarerweise ein Feind der offenen Gesellschaft, der Zivilgesellschaft und der menschlichen Emanzipation.
Damit das Neue Fuß fassen kann, braucht es meiner Meinung nach vor allem auch Begeisterung, Inspiration und Experimente. Wie können wir unsere Nörgelkultur überwinden?
Indem wir anfangen, uns keine Sorgen zu machen, sondern schlicht ausprobieren, ob das, was wir wollen, klappt. Ich sage immer nach Clint Eastwood: Wir reiten in die Stadt, der Rest ergibt sich. Schmeißen wir die alte Sicherheitskultur über Bord und investieren in unsere Unabhängigkeit. Werden wir also erwachsen.
Dann hören wir auch auf, rumzujammern.
Herr Lotter, vielen Dank für das Gespräch!
NEW-D Newsletter:


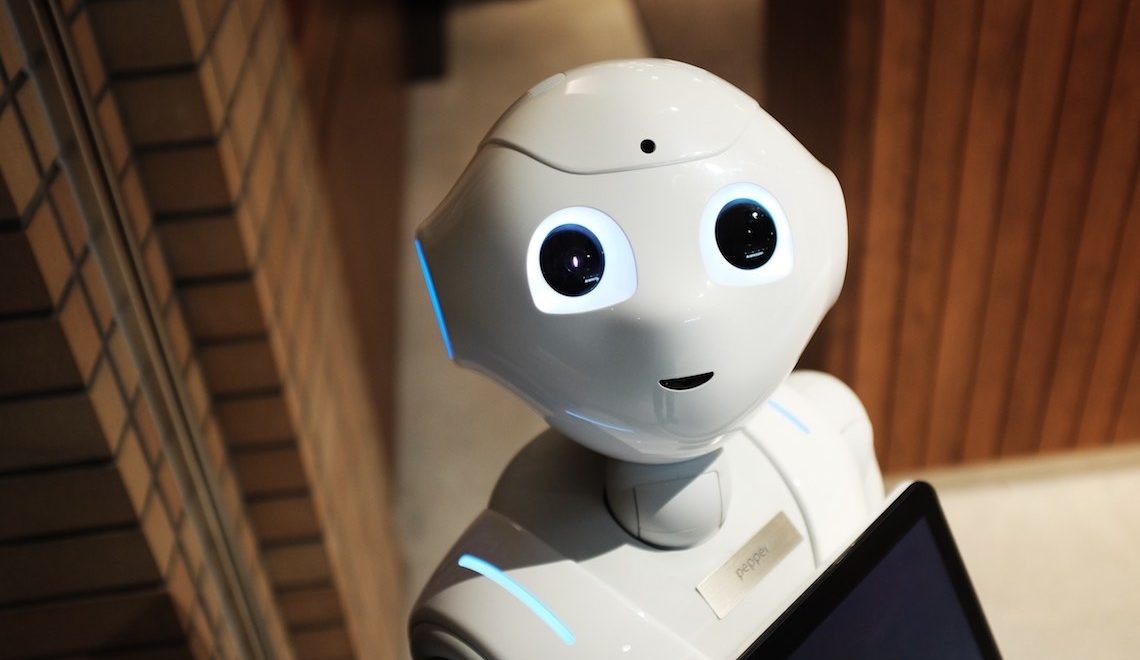

Aus der Reihe tanzen wird beäuigt, kritisiert und auch belächelt. Das hält nicht jeder aus. Bis derjenige natürlich zum neuen Zuckerberg oder Gates wird. Nörgeln ist da einfacher, da hat Herr Lotter völlig Recht. Und wenn der Erfolg dann kommt, dann sind wir die Neidgesellschaft. Beides Worte die mich nerven.
Was mich wirklich stört ist, dass wir nicht mehr stolz auf wissenschaftliche Errungenschaften sind. Deutsche Wissenschaftler in sämtlichen Diziplinen erfinden das Rad neu, machen Fortschritte und lösen Probleme, die uns zu Gute kommen. Aber was tun wir? Wir diskutieren ernsthaft ob Kinder geimpft werden müssen oder was die Kardashians wieder getan haben. Beides empfinde ich als Rückschritt.
Ich hätte gerne ein paar konkrete Punkte gelesen, wie Wolf Lotter meint sich keine Sorgen mehr zu machen, sondern mutig zu sein. Ein Blick in die Nachrichten macht es dem größten Optimisten schwer.
Yvonne